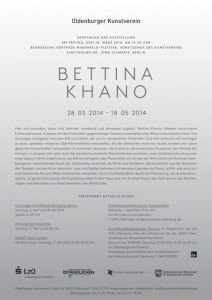Bettina Khano 28.3. 2014 – 18.5.2014
Oldenburger Kunstverein
Hier und woanders, davor und dahinter, anwesend und abwesend zugleich. Bettina Khanos Arbeiten konstruieren Erfahrungsräume, in denen sich die Ambivalenz gegenwärtiger Existenz in exemplarischer Weise nachvollziehen lässt. Ihre Setzungen changieren zwischen Bild und Objekt, die von ihr verwendeten Materialien sind kühl-technoid und vermögen es doch, geradezu magische Oberflächeneffekte herzustellen, die den Betrachter nicht nur visuell, sondern mit seiner gesamten Körperlichkeit einbeziehen. Es entstehen Szenerien, die formal an die erweiterten Situationen der Minimal Art erinnern, in jüngster Zeit aber auch die Vorstellung konkreter Räumlichkeiten evozieren, eines Schlafzimmers etwa oder eines Salons. Hierfür knüpft sie an die Bühnenhaftigkeit oder Theatralität an, die seit der Minimal Art als Merkmal raumbezogener, raumbildender Kunst gilt. Gleichzeitig verwendet sie Mittel und Verfahren, die tatsächlich aus den Bereichen des Theaters und des Kinos stammen. Lose und flexibel befinden sich einzelne Exponate im Raum, solitär und doch auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden, durch ihre Materialität, durch ihre Platzierung, durch eine Atmosphäre. So gerät nicht zuletzt die Ausstellung selbst in den Fokus und mit ihr jener Raum, der nach wie vor das Machen, Zeigen und Betrachten von Kunst bestimmt: der White Cube.
Angelockt werden wir durch ein skulpturales Objekt, das sich in seiner Erscheinung einer materiellen Zuordnung widersetzt (HD RF-1025, 2014). Mal scheint es wie ein weicher, samtiger Umhang, der gerade mitten im Raum abgestreift und achtlos liegengelassen wurde, mal wirkt die schillernde Oberfläche hart und kalt, wie ein Gesteinsfelsen. Welcher Sphäre entstammt dieses Material und worin besteht sein üblicher Gebrauch?
Ein Paravent, der sich grazil durch den Raum schlängelt, stellt sich uns in den Weg (Screen, 2014). Konzipiert um vor Blicken und Wind zu schützen, Inseln des Privaten und Intimen zu schaffen, markiert der Raumtrenner eine Grenze, auch wenn diese fragil und beweglich bleibt. Schließlich lassen sich bestehende Räume mit Hilfe des Paravents auf einfache Weise umstrukturieren. Der Paravent faltet ein Außen in das Innere eines Raumes ein und umgekehrt. Dies umso mehr Glasflächen unvermutet Blicke zulassen, während im nächsten Moment der Blick durch eine Spiegelung zurückgeworfen wird.
Der Spiegel ist eine zentrale Metapher in den Theorien des Kinos. Wie das Bild des Spiegels erweckt das Filmbild den Eindruck unmittelbarer Anwesenheit, während das, was wir sehen, uns doch absolut unzugänglich bleibt. Ein Bildschirm zeigt einen Film, der das Kino selbst zum Thema macht (KINO, 2012). Es erscheint als Schriftzug, als Objekt, als Vergehen von Zeit, als Verlauf von Tages- zu Kunstlicht.
Kunstlicht ist auch das Material, mit dem ein Scheinwerfer in einem schmalen Gang ein großes rechteckiges Lichtfenster auf die Wand wirft (Lichtrechteck, 2014). Aus der Ferne formt der Kegel des Lichts einen Körper, von Nahem verwandelt er sich in eine leuchtende Fläche auf der Wand.
Auf der anderen Seite der Wand, genau an derselben Stelle, hängt ein Vorhang. Von außen dringt warmes Licht herein, die Streben des Fensters zeichnen ein Muster, der Schattenriss eines Strauches ist zu erkennen (Draußen, 2014). Die Befragung des Raumes und seiner Grenzen, das Spiel von Anwesenheit und Abwesenheit, von Durchblicken und dem Zurückwerfen des Blicks findet sich auch in dieser Arbeit wieder. Denn tatsächlich handelt es sich nur um das Bild eines Fensters, einen Druck auf weißem Leinen. Während die Arbeit einerseits die Vorstellung auf die Welt außerhalb öffnet, betont sie andererseits die Abwesenheit dieser Welt und wirft uns auf unsere Anwesenheit hier vor Ort zurück.
Hier, das ist ein Raum im Raum im Oldenburger Kunstverein, die Kulisse eines White Cube, eingestellt in den größeren Ausstellungssaal. Der durch das Fenster dringende Lichtkegel, so scheint es, durchquert den Raum bis er auf die Aluminiumoberflächen des dem Vorhang gegenüber platzierten Diptychons (Davor, 2014) trifft. Der Raum selbst kommt zur Aufführung und mit ihm jene Ort- und Bezugslosigkeit, die zugleich die Problematik und das Potenzial des White Cube ausmachen: Die notorische Abgeschiedenheit von der kulturellen und sozialen Wirklichkeit einerseits ermöglicht andererseits, immer wieder aufs Neue eigene Welten entstehen zu lassen, in denen sich die Bedingungen und Möglichkeiten der Welt da draußen erproben, erforschen und erörtern lassen.
Jörn Schafaff